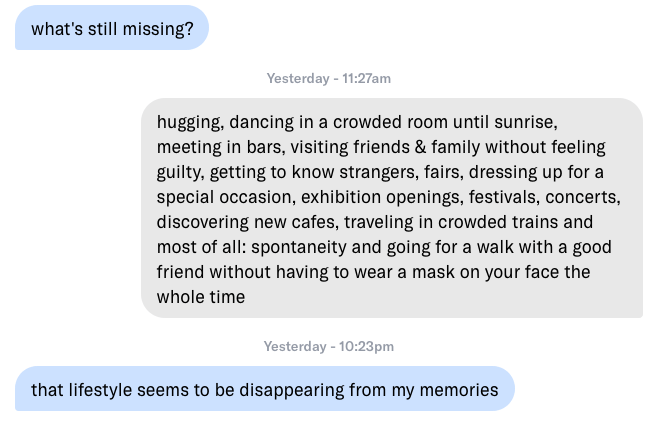Ende dieses Jahres sah ich ein kurzes Video des des Musikers-Modedesigners-Creative Directors-Musikproduzenten Stromae, das sich sofort in mein Herz brannte. In Deutschland ist Stromae hauptsächlich für sein trötiges Alors un dance (dö-dö-döö-dö-dö-dö) bekannt, vermutlich, weil es sich hervorragend als Fußballgesang eignet. In der frankophonen Welt hingegen ist der Belgier Paul Van Haver schon lange ein Megastar – und zwar völlig zurecht. Wer davon noch überzeugt werden muss, schaue sich bitte diesen Auftritt in der ausverkauften Arena Centre Bell in Montreal an. Oder das Video zu seinem Track Tous les mêmes, in dem er nicht nur eine, sondern gleich zwei Hauptrollen übernimmt. Oder die Preisverleihung der NRJ Music Awards, wo er puppengleich von zwei Männern in die Arena getragen wird.
Seit meiner Zeit in Frankreich war es mein Traum, Stromae live zu sehen. »Da kannst du lange warten«, war der trockene Kommentar einer frankophilen Mediziner-Freundin dazu. Denn Van Haven musste 2015 eine Tour durch Afrika abbrechen, weil er ein Malariamedikament nicht vertragen hatte – die Folge waren Panikattacken, Depressionen und suizidale Gedanken. Lange war unklar, ob er je wieder auftreten würde.
Zu meiner Überraschung erschien in diesem Jahr, sieben Jahre nach meinem Frankreichaufenthalt, das Album Multitude, auf dem Stromae Instrumente und Sounds aus der ganzen Welt vereint. Mit der gleichnamigen Tour trat er gleich viermal (!) im ausverkauften Centre Bell in Quebec auf, er performte den Song L’enfer über seine Depression live in der Nachrichtensendung JT de 20 H (dem französischen Pendant zur Tagesschau), und Mitte des Jahres kam er mit Brillianten behängt zur Met Gala. Der Phönix aus der Asche gleitete also nicht nur durch die Lüfte, er trug dabei auch noch Cartier.
Dennoch war das Reel, das für mich so symbolisch für mein Jahr 2022 steht, kein Glamour-Moment oder einer mit Millionenpublikum. Es zeigt den Künstler scheinbar allein tanzend beim einem Soundcheck in einer Arena – allein am Ende des Videos sind im Hintergrund einige Team-Mitglieder auf der Bühne zu sehen. Dazu ist eine Akustik-Version des Liedes La Solassitude zu hören – ein Wortspiel aus den Wörtern lassitude (Überdruss, Ermattung, Müdigkeit) und solitude (Einsamkeit). »Le célibat me fait souffrir de solitude, La vie de couple me fait souffrir de lassitude«, singt Stromae – das Zölibat bestraft mich mich Einsamkeit, das Eheleben mit Müdigkeit.
Das Video beschreibt für mich einen Neuanfang, aber auch die Ruhe vor dem Sturm. Für mich steht es für all die Momente vor den Vorträgen, die ich in diesem Jahr halten durfte. Oder den Moment, kurz bevor die Studierenden in mein Seminar kommen oder bevor wir ein neues Magazin auf Social Media releasen, irgendwo zwischen gespannter Freudigkeit und grenzenloser Nervosität.
Und dann gibt es noch die lyrischen Ebene – ein ständiges Hin- und Hergerissensein zwischen Alleinsein und Nicht-Alleinsein-Wollen, zwischen unglücklicher Zweisamkeit und selbstgewählter, unglücklicher Freiheit. zwischen Wollen und Nicht-Können. Zwischen Pflichten und Freizeit. Für den Moment, in dem man ein unangenehmes Telefonat oder Gespräch beendet hat. Für all die Samstage, in denen ich drinnen saß und noch an etwas arbeiten musste, und mir vorkam wie ein Schulkind, das am liebsten nur aufstehen und spielen gehen möchte.
Die Geschichte von Stromaes Karriere zeigt mir auch, wie fragil Gesundheit (und damit Karrierre) ist. Das durfte ich leider auch selbst erfahren, selten war ich so oft krank wie in diesem seltsamen postpandemischen Jahr. Ich las Berichte über Long Covid, die mir Angst machten. Ich weinte in Arztpraxen und Zügen, und feierte trotzdem Monate später große Partys. Dazwischen Nachrichten aus dem Krieg, Sorgen, Hoffnungen. Zwölf Monate lang ein ständiges Hin und Her zwischen Nähe und Ferne, Ruhe und Lärm, Einsamkeit und Socializen-Müssen, Tränen aus Verzweiflung und aus Rührung. Im neuen Jahr darf es gern etwas ruhiger werden. Weniger solassitude, mehr confiance.
Meinen musikalischen Jahresrückblick (natürlich mit Stromae) findest du hier.